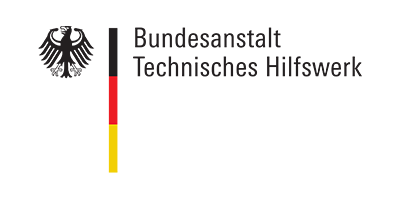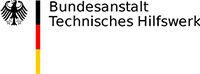Meppen. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die Bundeswehr beim Moorbrand mit über 300 Einsatzkräften. Neben der eigentlichen Aufgabe – dem Füllen des Moors mit Wasser stellte das THW in kürzester Zeit eine Zeltstadt auf um die Einsatzkräfte unterzubringen und zu versorgen. Neben Ver- und Entsorgung bauten die Spezialisten auch die Stromversorgung auf und kümmerten sich um die fachgerechte Unterbringung. Das THW Osterode stellt hierbei zeitweise mit bis zu 20 Helferinnen und Helfern das Personal für die Führungsstelle des Feldlagers, sowie für die Stellen Betrieb, Belegung und Material.Der Einsatz dauert noch an.
„Wasser marsch“ könnte der Untertitel zum Einsatz im Moor lauten. Die Einsatzkräfte des THW bekamen die Aufgabe das Moor zu wässern um die Brände, die teilweise tief in der Erde/Moor vor sich hin brannten zu löschen. Mit herkömmlichen Löschmitteln ist diese Aufgabe nicht zu lösen gewesen, das Moor mußte geflutet werden. Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen aus den THW-Landesverbänden Bremen/Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen machten sich auf den Weg auf das Bundeswehrgelände. Im Gepäck hatten sie die Großpumpen der Fachgruppe mit einer Pumpleistung von 5.000 – 25.000 Liter / Minute und diverse Zusatzpumpen. Insgesamt stand in diese Zusammenstellung eine Pumpleistung von über 100.000 L/Minute zur Verfügung. Das Wasser wurde erst einige Kilometer zum Einsatzort gepumpt um dann das Moor zu fluten.
Das Gelände bot keinerlei Infrastruktur wie Gebäude etc., und die Einsatzkräfte mussten über etliche Tage bis Wochen auf dem Gelände verbleiben.
Das THW setzte für die Einsatzkräfte erstmalig das System Bereitstellungsraum 500 (BR 500) ein.
Der BR 500 ist dafür ausgelegt völlig autark 500 Einsatzkräfte oder mehr zu versorgen und unterzubringen.
Unterschiedliche Spezialisten arbeiteten routiniert zusammen und stellen den Bereitstellungsraum und das dazugehörige Feldlager in kürzester Zeit auf die ausgesuchte Fläche. Die Einsatzkräfte bauten die Trinkwasserversorgung mit der Fachgruppe Trinkwasserversorgung auf, andere Teile aus der Fachgruppe Elektroversorgung kümmerten sich um die fachgerechte Verlegung und Betrieb der Elektroversorgung. Fachgruppen Führung&Kommunikation übernahmen in den Faltanhängern und den dazugehörigen Fahrzeugen die Koordination und Verwaltung des Systems. Weitere Einheiten aus etlichen Ortsverbänden unterstützten beim Auf- und Abbau des kompletten Systems.
Das THW Osterode stellte hierbei zeitweise mit bis zu 20 Helferinnen und Helfern das Personal für die Führungsstelle des Feldlagers, sowie für die Stellen Betrieb, Belegung und Material.Der Einsatz dauert noch an.
Text: Stefan Riemke, THW Osterode
Bilder: André Tuschek, THW Osterode
#BR 500
Der BR ist die Sammelbezeichnung für Orte, an denen Einsatzkräfte und Einsatzmittel für den unmittelbaren Einsatz oder vorsorglich gesammelt, gegliedert und bereitgestellt oder in Reserve gehalten werden.“ (vgl.: Feuerwehrdienstvorschrift 100 (FwDV 100), S. 52 und THW-DV 1-100 Ziffer 9.3.4 sowie THW Handbuch Führen Ziffer 9.3.3.1).
Der Bereitstellungsraum (BR) sollte sich abgesetzt vom eigentlichen Einsatzgebiet befinden, damit die dort befindlichen Einheiten für den Einsatz gegliedert und bereitgestellt oder in Reserve zur Wahrnehmung von Verstärkungs- und Ablösungsaufgaben gehalten werden können.
Es gibt verschiedene Arten von BR, die je nach Lage und Einsatz genutzt werden:
Der allgemeine BR: Dabei handelt es sich um einen Raum, an dem sich die Einsatzkräfte sammeln und einem geordneten Abruf der Einsatzleitung zum Anmarsch an die Einsatzstelle folgen können. Dieser Typ BR ist nur geeignet für eine kurzfristige Nutzung.
Der BR mit Meldekopf: Für eine kurz- bis mittelfristige Nutzung ist diese taktische Einsatzoption gedacht. Der Meldekopf weist die anrückenden Einheiten in die Raumordnung ein und registriert sie. Außerdem meldet er an die Einsatzleitung die verfügbaren Einsatzkräfte im BR und leitet eingehende Einsatzaufträge an die Einsatzkräfte im BR weiter.
Der BR mit Führungsstelle: Dieser dient für eine mittelfristige bis längere Nutzungsdauer und kann für mehrere hundert Einsatzkräfte eingerichtet werden. Für taktische Maßnahmen in dieser Größenordnung wurde sowohl die Ausbildung als auch die Einsatztaktik angepasst und weiterentwickelt.
Kriterien für das Einrichten und Betreiben von BR in dieser Größenordnung sind:
Führung des Bereitstellungsraumes durch eine Führungsstelle
Einsatz von ausgebildeten Betriebskräften für die Planung, Vorbereitung und den Betrieb aller Infrastruktur-/ Logistikmaßnahmen
Planungsansatz zur Aufnahme von Einsatzkräften: Im „System BR 500“ geht man von 500 Personen aus. Durch eine Anpassung in der materiellen Ausstattung ist die Aufbauorganisation dieses Systems auch für bis zu 1.000 Einsatzkräfte geeignet.
Abstellfläche für die Einsatzkraftfahrzeuge der Einsatzkräfte
Unterbringung der Einsatzkräfte unter Nutzung von verfügbaren ortsfesten oder temporären feldmäßigen Unterbringungsvarianten
Verpflegung der im Bereitstellungsraum untergebrachten Einsatzkräften
#THW
Das Technische Hilfswerk ist die operative Bevölkerungsschutzorganisation des Bundes. Sie leistet technisch-logistische Hilfe im Inland wie im Ausland. Rund 80.000 Menschen, darunter Techniker, Ingenieure, aber auch Spezialisten aus vielen weiteren Fachrichtungen, engagieren sich ehrenamtlich in 668 THW-Ortsverbänden. Sie sind kompetente Partner der Feuerwehren, der Polizei sowie der Hilfsorganisationen bei der Abwehr von Gefahren und der Beseitigung der Folgen von Unfällen und Katastrophen. Unterstützt wird dieses ehrenamtliche Engagement durch rund 1.000 hauptamtlich Beschäftigte in den 66 Regionalstellen, den acht Dienststellen der Landesverbände, der THW-Bundesschule sowie der THW-Leitung in Bonn. Das THW ist bundesweit einheitlich organisiert und ein verlässlicher Partner. Auf allen örtlichen Ebenen stehen Ihnen Ansprechpartner zur Verfügung. Wenn Sie das Technische Hilfswerk anfordern wollen, brauchen Sie nur mit dem nächstgelegenen THW-Ortsverband oder der THW-Regionalstelle Kontakt aufzunehmen. Sie eröffnen den Zugang zum „technischen Baukasten“ des THW, der für eine Reihe von Schadenslagen die passenden Spezialeinheiten mit fachkundigen Einsatzkräften aus dem gesamten, bundesweiten Einsatzpotenzial bereithält.